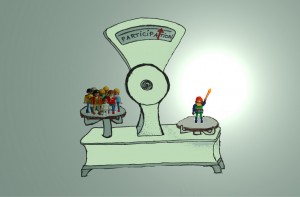
CC by-nc-sa 2.0 by verbeeldingskr8 (flickr)
Nach den Erfahrungen und Beobachtungen der letzten Jahre könnte ich 3 von sicherlich Hunderten von Problemen ausmachen, die eine Partizipationskultur verhindern:
- Unterscheidung in Organisierende von Partizipation und ihre Teilnehmenden
- Partizipation ist nur Teil des Prozesses und nicht der Prozess selbst
- Partizipation fördert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bestehenden und stellt die Verantwortlichen in Frage
Partizipationsgewährende und Partizipierende
Partizipation kennt zumindest in den Einstellungsoptionen unserer Gesellschaft zwei verschiedene Perspektiven. Zum einen die, die Partizipation gewähren und zum anderen die, die partizipieren. In vielen Fällen wird Partizipation als Zugeständnis der Entscheidenden empfunden, nicht aber als Normalität. Und natürlich ist der Rahmen klar umrissen und die Regeln klar. Partizipation bezieht sich also selten auf ihr Setting, und die Einstellungsoptionen. Im schlechtesten Fall dient Partizipation nur der Legitimation der anschließenden Entscheidung, nach dem Motto, „Meckern hilft nicht, ihr hattet ja die Möglichkeit mitzumachen“. Das Problem ist aber die Vorgabe des Rahmens, es entspricht dem goldenen Käfig. Ein gut gemeinter Ansatz bewirkt das Gegenteil. Die Beteiligten fühlen sich selten ernst genommen. Da hilft auch Transparenz bei der Herbeiführung der Entscheidung am Ende wenig.
Partizipation ist nur eine Phase im Prozess
Ich spreche hier allgemein von Prozess, weil Partizipation das Zauberwort in so vielen verschiedenen Zusammenhängen ist, denen aber immer die obengenannten 3 Probleme innewohnen.
Vor der Partizipation steht eine Einleitungsphase und danach meist eine Entscheidungsphase. Partizipation beginnt meist mit einem „… und jetzt seid ihr dran“ und endet mit einem „Danke für euer Engagement und die zahlreichen Ideen“. Im besten Fall wird die Entscheidung zusammen mit den Partizipierenden gefällt, weniger in politischen Prozessen, aber wenn es um nicht viel oder um um ein kalkuliertes Viel geht, ist so etwas zu beobachten.
Partizipation begünstigt Kritik am Rahmen und dem gesamten Prozess
Zusammen mit den Teilnehmenden einer einwöchigen Veranstaltung im Rahmen von pb21.de haben wir zu Beginn des Workshops den Raum eingerichtet. Es war ein sehr praktischer Einstieg zu mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Anschließend fand eine Diskussion zur digitalen Hausordnung statt. Zu keinem Zeitpunkt des Seminars wurde so kritisch über die Art und Weise der Seminarkonzeption gesprochen, wie an diesem ersten Tag. Ich bin sicher, dass das Partizipationsversprechen, dass die Gestaltung des Raumes (Teil des Seminarrahmens) für den weiteren Workshopverlauf offerierte, die Kultur der kritischen Auseinandersetzung nicht zuletzt mit den Rahmenbedingungen (Seminarkonzeption) gefördert hat. Es erscheint mir auch einleuchtend, das Partizipation die Auseinandersetzung und die Gestaltungsperspektive mit ihren Rahmenbedingungen fördert. Und es erscheint mir ebenso einleuchtend, das die kritische Auseinandersetzung mit dem Rahmen oder den vorbereiteten Inhalten den Referenten gar nicht gefällt.
Wie kann Partizipation gelingen?
Wenn man all das weiß, gibt es eigentlich nur einen Ausweg. Es geht nicht um Partizipation, sondern um die Schaffung partizipativer Kultur. Der Unterschied ist „Prozess statt Phase“. Wenn Partizipation also nicht nur Teil eines Prozesses, sondern der Prozess selber werden soll, dann muss sie von den Partizipierenden im politischen vom Bürger ausgehen, d.h. es braucht eine Kultur in der das Einmischen und das fängt häufig mit Kritik an den Gestaltenden Kräften selbst an, erwünscht ist.
Barcamps sind wichtige Inkubatoren für eine Partizipationskultur. Leider enden Barcampsessions viel zu häufig bei dem „man müßte mal“ statt bei der Geburt eines neuen partizipationsorientierten Projekts, von guten Beispielen abgesehen.
Was die Piraten mit der Herbeiführung politischer Entscheidungen wagen, kann man als wichtigen Ansatz für die Initiierung einer Partizipationskultur verstehen.
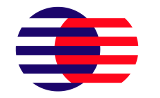

 Creative Commons Attribution
Creative Commons Attribution
Danke für Deinen Beitrag, Guido! Das spricht mich sofort an: Habe gerade einen Blogpost zur Wirkung von so vielen gut gemeinten Aktionen für Teilnehmer in Seminaren geschrieben (http://khpape.wordpress.com/2012/11/24/folterkammer-fur-lerner/). Alles was wir uns in Lern-Settings für Teilnehmer ausdenken ist immer irgendwie auch angeordnet und bitte auszuführen. Dabei scheinen Lehrende oft sogar selbst den Eindruck zu haben, sie geben den Teilnehmenden hier ja Freiheiten etwas selbst zu machen. Aber die Machtverhältnisse ändern sich dadurch ja nicht.
Also echte Partizipation geht nur auf gleicher Augenhöhe unter sich gleichberechtigt Fühlenden – mit offenem Ergebnis. Partizipation ist etwas sehr Ur-Demokratisches.
Und trotzdem hat jemand zu einem Seminar eingeladen, jemand fühlt sich verantwortlich zu moderieren, jemand möchte dem ganzen einen Rahmen geben und da ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen. Meiner Auffassung nach prägen sich solche Lernkulturen schnell und wir geben nur allzu gerne die Verantwortung ab, bzw. wollen uns umgekehr nicht in den Vordergrund spielen. Welche Anzeichen seitens des Referenten würden es erlauben, den Prozess wirklich mitzugestalten und wo hört das dann auf. Dazu hat sich auch ein kleiner Diskussionsfaden auf google+ entsponnen, auf den ich hier hinweisen will.
[…] @gibro über Partizipation […]
Ergänzung: Dein Text erinnerte mich an
„Partizipatives Lernen mit dem Social Web gestalten – Zum Widerspruch einer ‹verordneten Partizipation›“ von Kerstin Mayrberger. Besonders ab Seite 6 die verschiedenen Stufen der Partizipation.
http://www.medienpaed.com/21/mayrberger1201.pdf
mmh, guter Post. Schließt eigentlich ganz gut an das Buch an, das ich gerade lese (vor allem den Teil zur Öffentlichkeit):
http://books.google.de/books?id=cJVfdFIi2NgC
Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien. Radikaler Wandel als schrittweise Rekonfiguration.
Viele Grüße,
Lothar
Hallo Guido,
aus der Perspektive des Freiwilligenmanagements kann ich allen deinen Punkten zustimmen. Ich sehe aber um diese kritischen Punkte für die Partizipation eine große Klammer: die Distiktion.
Insbesondere dort, wo spezialisierte Hauptamtliche auf sog. „Laien“ treffen, setzen unmittelbar die Verhandlungen des „Wer-Darf-Was“ ein. Meistens gewinnen die Hauptamtlichen und machen die Freiwilligen zu Laien, die nur (aus)helfen dürfen — dies übrigens auch dann, wenn sie deutlich in der Unterzahl sind. Genauso beobachte ich das auch in der Debatte um Partizipation: Es wird unterschieden — es muss offenbar unterschieden werden — zwischen denen die Machen und denen die Mitmachen. Wie selbstverständlich werden die Mitmacher von den Machern in ihrer Gestaltungsfreiheit (oder -macht) eingeschränkt, weil sie sonst die Hoheit (Macht) über ihr Projekt verlieren. Und deshalb verhindern (fürchten) sie auch die kritische Auseinandersetzung mit „Laien“.
Seit Jahren rede ich darüber, dass man Menschen die Möglichkeit geben muss mitzugestalten. Selten geligt das über ein kleines Projektchen (also klar Zeitbegrenzt). Dennoch glaube ich nicht, dass wir ein Partizipationsproblem haben. Wir haben ein Anerkennungsproblem: Ganz besonders die, die freiwilliges Engagement und Partizipation im Alltag möglich machen sollen (Sozialarbeiter!nnen, Freiwilligenmanager!nnen usw.) fühlen sich nur selten anerkannt und damit selbstbewusst genug, echte Partizipation zuzulassen, also auch andere und ihre Gestaltungsansprüche anzuerkennen. Das wiederum hält die Adressanten der Partizipationsmöglichkeiten fern, die so aber auch niemals lernen, mit echten Partizipationsangeboten (wenn es sie mal gibt) umzugehen, sprich auch die Ansprüche von spezialisierten Hauptamtlichen anzuerkennen.
So führt eins zum anderen und ich befürchte es wird ein ewiger „Kampf um Anerkennung“ bleiben.
Gruß
Hannes
Hannes weist auf Wirkungen hin, die „Partizipationsgewährende“ spürbar werden lassen. Da stimme ich zu, so kommt keine wirkliche Partizipation zu Stande. Partizipation setzt aus meiner Sicht wirklich die gleiche Augenhöhe aller zum inhaltlichen Vorgehen – und wohl auch bei der Auswahl des Thamas voraus. Das beste Beispiel dafür sind Foren im Internet. Die entstehen, weil einer ein Tehema einbringt (kann man als Vorschlag verstehen), auf das andere einsteigen, und aus eigenem Antrieb gleichberechtigt weiterentwickeln. Die Rahmenbedingungen (hier das ausgwählte Forum, die Plattform) werden dabei aber i.d.R. nicht in Frage gestellt, sondern als hilfreichen Service akzeptiert (das entspricht der Gestaltung des Raumes in Guidos Beispiel).
Hannes, da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt eine Reihe von Faktoren, die Partizipation beungünstigen. Ich habe eher auf die Rahmenbedingungen abgehoben und wollte deutlich machen, dass Partizipation auch von allen beteiligten mit allen Konsequenzen erwünscht ist, gegebenenfalls auch die Gewährenden selbst in Frage stellt.
Genau das ist mir wichtig. Partizipation bedeutet mehr, als nur an einer Sache mitzuwirken, es bedeutet, sich diese Sache zu eigen zu machen und das kann nur dann funktionieren, wenn die Verantwortlichen Macht aus der Hand geben.
Spon hat über die Demokratie-Farce bei Facebook geschrieben. Und auch das untermauert meine These solange Partizipationsgewährende den Prozess gestalten gibt es keinen Grund, das Partizipation zu nennen, allerbestens Pseudopartizipation http://m.spiegel.de/netzwelt/web/a-871949.html#spRedirectedFrom=www
gelungene Analyse… in der Governance-Forschung weiß man das ja schon seit langem. Setzt man auf „neue“ offene Partizipationstools, kommt es am Ende doch nur zu einer Legitimationsrechtfertigung und Machtsicherung der bereits dominierenden Interessen. Erfolge bei der Inklusion und Teilhabe wurden kaum erzielt. Dennoch kann das Ziel weiterhin nur sein, nicht nur Tools nutzen und scheitern, sondern auf eine (wie du so schön schreibst) Partizipations-Kultur hinarbeiten.